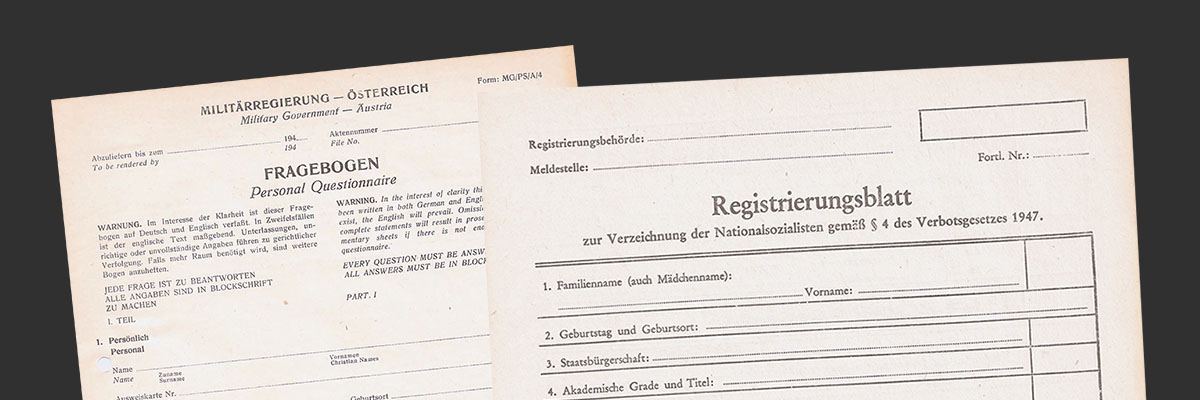„Wir wollen, dass die Nationalsozialisten, die sich keines Vergehens schuldig gemacht haben, entregistriert werden…“
Anton Neumayr senior, der selbst das Konzentrationslager Dachau überlebte, bekleidete im Bundesland Salzburg nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche wichtige Ämter auf Landes- und Gemeindeebene, unter anderem als Landeshauptmann-Stellvertreter und Bürgermeister von Salzburg. Im Zuge der ersten freien Landtagswahlen vom 25. November 1945 absolvierte der Sozialdemokrat zahlreiche Wahlkampfauftritte, dabei nahm er auch zur Entnazifizierung Stellung. So forderte er etwa am 3. November 1945 die Entregistrierung all jener ehemaligen Nationalsozialisten, „die sich keines Vergehens schuldig gemacht haben“:
“Es muss für die KZler, für die Invaliden, für die Witwen und Waisen gesorgt werden und die Partei wird den Heimkehrern ihre größte Aufmerksamkeit schenken müssen… Wir wollen, dass die Nationalsozialisten, die sich keines Vergehens schuldig gemacht haben, entregistriert werden, dass sie eingeschaltet werden in den Arbeitsprozess, dass auch in ihre Familien wieder Glück und Friede einkehren… Sie sollen nachdenken, was diejenigen ertragen mussten, die in den Konzentrationslagern waren, was die Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen leiden, welcher Schmerz den Witwen und Waisen dieses Krieges zugefügt worden ist. Die Entregistrierung muss gerecht und nach gleichen Grundsätzen durchgeführt werden.”
Neumayr, Anton (1945). Wahlrede vom 3. November 1945. Demokratisches Volksblatt, 5. November 1945.
„Man geht auf der einen Seite zu weit und auf der anderen Seite zu wenig weit. Es ist zu viel und zu wenig zugleich.“
Friedrich Hillegeist, SPÖ-Nationalratsabgeordneter und Vorsitzender der Gewerkschaft der Angestellten in der Privatwirtschaft (GAP), fasste die vielschichtigen Problematiken rund um das Verbotsgesetz bei einer Parlamentssitzung am 22. März 1946 eindrücklich zusammen:
„Wir haben ein Verbotsgesetz, wir haben weiß Gott wie viele Kommissionen und Sonderkommissionen, wir haben ein Wirtschaftssäuberungsgesetz, das den Dienstgebern die Möglichkeit gibt, die Betriebe zu säubern, auch den Betriebsräten ist das Recht gegeben, Maßnahmen zu treffen, der Gewerkschaftsbund ist ermächtigt, Anträge auf Kündigung zu stellen, wenn die beiden Vorinstanzen nichts getan haben, wir haben Kommissionen bei jedem Arbeitsamte, die von Amts wegen eingreifen können, wir haben ein Ministerkomitee für die Säuberung der öffentlichen Verwaltung und der Wirtschaft, wir haben die Säuberungskomitees in den Ländern, darüber hinaus säubern die Polizei und Militärbehörden im eigenen Wirkungskreis, aber das Ergebnis ist trotzdem absolut unbefriedigend. Man geht auf der einen Seite zu weit und auf der anderen Seite zu wenig weit. Es ist zu viel und zu wenig zugleich. Wir erleben immer wieder, daß in der Bevölkerung der Vorwurf erhoben wird, es geschehe nichts, und daß mit einigem Recht gesagt wird: die Kleinen hängt man, aber die Großen läßt man laufen. Es ist daher wirklich berechtigt, wenn wir sagen: alle Maßnahmen sollen auf Grund gesetzlicher Bestimmungen durchgeführt werden und man soll uns es überlassen, diese Gesetze zu beschließen und auch praktisch anzuwenden. Wir werden dieses Problem lösen, ohne Gefühl der Rache und nicht aus einem Bedürfnis nach Vergeltung.“
Hillegeist, Friedrich (1946). Berichterstatter zum Wirtschaftssäuberungsgesetz. Stenographisches Protokoll, 12. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, 22. März 1946, S. 156.
„Die Entnazifizierung ist so ziemlich beendet.“
Zwischen dem Alliierten Rat und der österreichischen Bundesregierung gab es im Verlauf des Jahres 1946 unterschiedliche Auffassung über den Stand der Entnazifizierung. Nach erneuter Kritik erklärkte Bundeskanzler Leopold Figl (ÖVP) im Wiener Kurier die Entnazifizierung Ende November 1946 für „ziemlich beendet“:
„Die Entnazifizierung ist so ziemlich beendet“, erklärte Bundeskanzler Ing. Figl auf die Frage, wie weit diese bisher gediehen sei. „Das schließt aber nicht aus, daß vielleicht noch hie und da ein Fall nachträglich bekannt wird, denen wir natürlich sofort auf den Grund gehen. Auch die Entnazifizierung der Wirtschaft ist fast abgeschlossen und ich hoffe, daß die baldige Verabschiedung des Nazigesetzes uns die Möglichkeit geben wird, diese Frage ein für allemal zu erledigen.“
Leopold Figl (1946). Mehr Polizei oder Bundesheer notwendig. Wiener Kurier, 25. November 1946, Seite 1. ANNO/Österreichische Nationalbibliothek